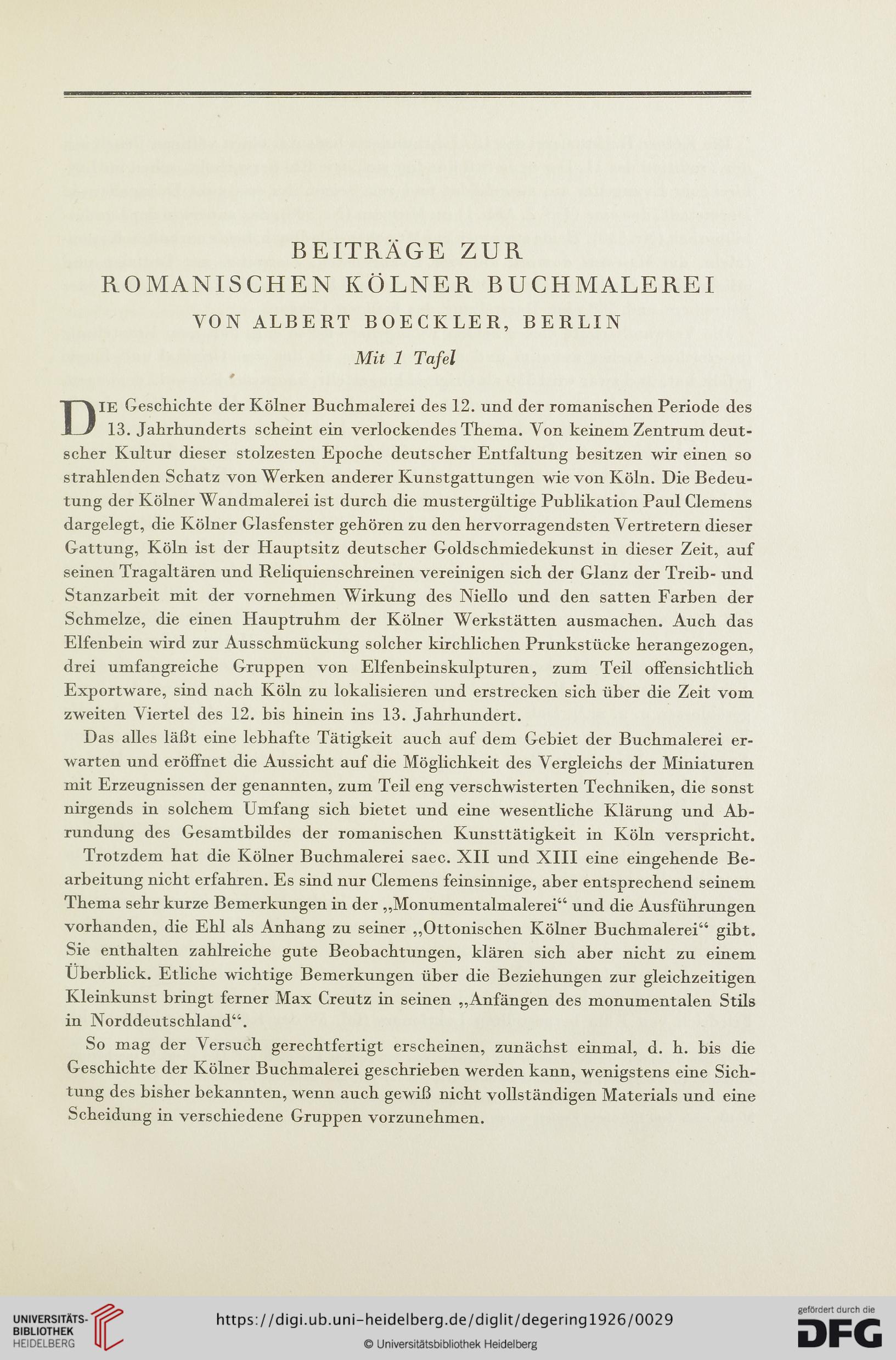BEITRÄGE ZUR
ROMANISCHEN KÖLNER BUCHMALEREI
VON ALBERT BOECKLER, BERLIN
Mit 1 Tafel
DIE Geschichte der Kölner Buchmalerei des 12. und der romanischen Periode des
13. Jahrhunderts scheint ein verlockendes Thema. Von keinem Zentrum deut-
scher Kultur dieser stolzesten Epoche deutscher Entfaltung besitzen wir einen so
strahlenden Schatz von Werken anderer Kunstgattungen wie von Köln. Die Bedeu-
tung der Kölner Wandmalerei ist durch die mustergültige Publikation Paul Clemens
dargelegt, die Kölner Glasfenster gehören zu den hervorragendsten V ertretern dieser
Gattung, Köln ist der Hauptsitz deutscher Goldschmiedekunst in dieser Zeit, auf
seinen Tragaltären und Reliquienschreinen vereinigen sich der Glanz der Treib- und
Stanzarbeit mit der vornehmen Wirkung des Niello und den satten Farben der
Schmelze, die einen Hauptruhm der Kölner Werkstätten ausmachen. Auch das
Elfenbein wird zur Ausschmückung solcher kirchlichen Prunkstücke herangezogen,
drei umfangreiche Gruppen von Elfenbeinskulpturen, zum Teil offensichtlich
Exportware, sind nach Köln zu lokalisieren und erstrecken sich über die Zeit vom
zweiten Viertel des 12. bis hinein ins 13. Jahrhundert.
Das alles läßt eine lebhafte Tätigkeit auch auf dem Gebiet der Buchmalerei er-
warten und eröffnet die Aussicht auf die Möglichkeit des Vergleichs der Miniaturen
mit Erzeugnissen der genannten, zum Teil eng verschwisterten Techniken, die sonst
nirgends in solchem Umfang sich bietet und eine wesentliche Klärung und Ab-
rundung des Gesamtbildes der romanischen Kunsttätigkeit in Köln verspricht.
Trotzdem hat die Kölner Buchmalerei saec. XII und XIII eine eingehende Be-
arbeitung nicht erfahren. Es sind nur Clemens feinsinnige, aber entsprechend seinem
Thema sehr kurze Bemerkungen in der „Monumentalmalerei44 und die Ausführungen
vorhanden, die Ehl als Anhang zu seiner „Ottonischen Kölner Buchmalerei44 gibt.
Sie enthalten zahlreiche gute Beobachtungen, klären sich aber nicht zu einem
Überblick. Etliche wichtige Bemerkungen über die Beziehungen zur gleichzeitigen
Kleinkunst bringt ferner Max Creutz in seinen „Anfängen des monumentalen Stils
in Norddeutschland44.
So mag der Versuch gerechtfertigt erscheinen, zunächst einmal, d. h. bis die
Geschichte der Kölner Buchmalerei geschrieben werden kann, wenigstens eine Sich-
tung des bisher bekannten, wenn auch gewiß nicht vollständigen Materials und eine
Scheidung in verschiedene Gruppen vorzunehmen.
ROMANISCHEN KÖLNER BUCHMALEREI
VON ALBERT BOECKLER, BERLIN
Mit 1 Tafel
DIE Geschichte der Kölner Buchmalerei des 12. und der romanischen Periode des
13. Jahrhunderts scheint ein verlockendes Thema. Von keinem Zentrum deut-
scher Kultur dieser stolzesten Epoche deutscher Entfaltung besitzen wir einen so
strahlenden Schatz von Werken anderer Kunstgattungen wie von Köln. Die Bedeu-
tung der Kölner Wandmalerei ist durch die mustergültige Publikation Paul Clemens
dargelegt, die Kölner Glasfenster gehören zu den hervorragendsten V ertretern dieser
Gattung, Köln ist der Hauptsitz deutscher Goldschmiedekunst in dieser Zeit, auf
seinen Tragaltären und Reliquienschreinen vereinigen sich der Glanz der Treib- und
Stanzarbeit mit der vornehmen Wirkung des Niello und den satten Farben der
Schmelze, die einen Hauptruhm der Kölner Werkstätten ausmachen. Auch das
Elfenbein wird zur Ausschmückung solcher kirchlichen Prunkstücke herangezogen,
drei umfangreiche Gruppen von Elfenbeinskulpturen, zum Teil offensichtlich
Exportware, sind nach Köln zu lokalisieren und erstrecken sich über die Zeit vom
zweiten Viertel des 12. bis hinein ins 13. Jahrhundert.
Das alles läßt eine lebhafte Tätigkeit auch auf dem Gebiet der Buchmalerei er-
warten und eröffnet die Aussicht auf die Möglichkeit des Vergleichs der Miniaturen
mit Erzeugnissen der genannten, zum Teil eng verschwisterten Techniken, die sonst
nirgends in solchem Umfang sich bietet und eine wesentliche Klärung und Ab-
rundung des Gesamtbildes der romanischen Kunsttätigkeit in Köln verspricht.
Trotzdem hat die Kölner Buchmalerei saec. XII und XIII eine eingehende Be-
arbeitung nicht erfahren. Es sind nur Clemens feinsinnige, aber entsprechend seinem
Thema sehr kurze Bemerkungen in der „Monumentalmalerei44 und die Ausführungen
vorhanden, die Ehl als Anhang zu seiner „Ottonischen Kölner Buchmalerei44 gibt.
Sie enthalten zahlreiche gute Beobachtungen, klären sich aber nicht zu einem
Überblick. Etliche wichtige Bemerkungen über die Beziehungen zur gleichzeitigen
Kleinkunst bringt ferner Max Creutz in seinen „Anfängen des monumentalen Stils
in Norddeutschland44.
So mag der Versuch gerechtfertigt erscheinen, zunächst einmal, d. h. bis die
Geschichte der Kölner Buchmalerei geschrieben werden kann, wenigstens eine Sich-
tung des bisher bekannten, wenn auch gewiß nicht vollständigen Materials und eine
Scheidung in verschiedene Gruppen vorzunehmen.